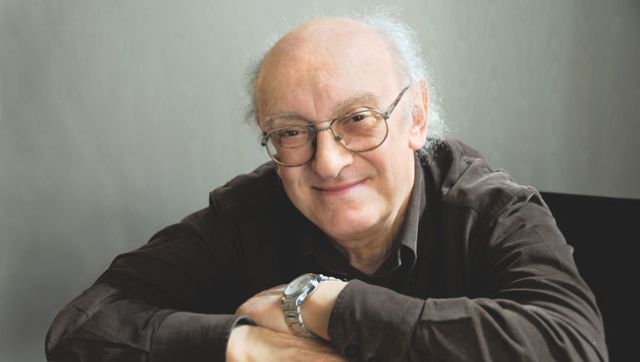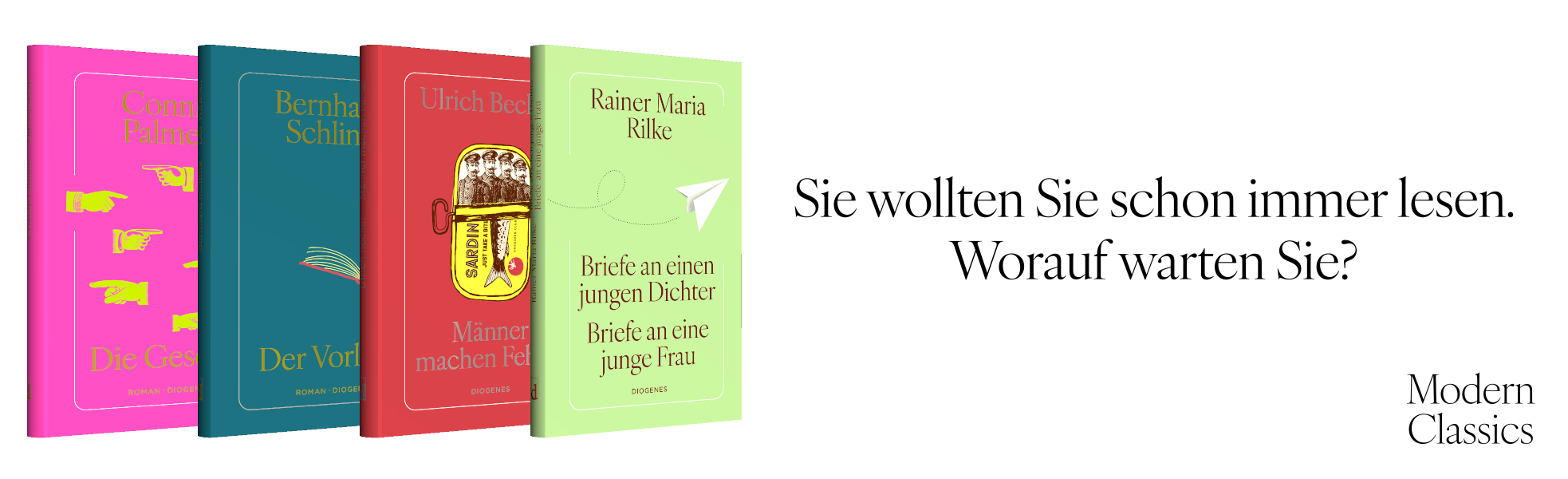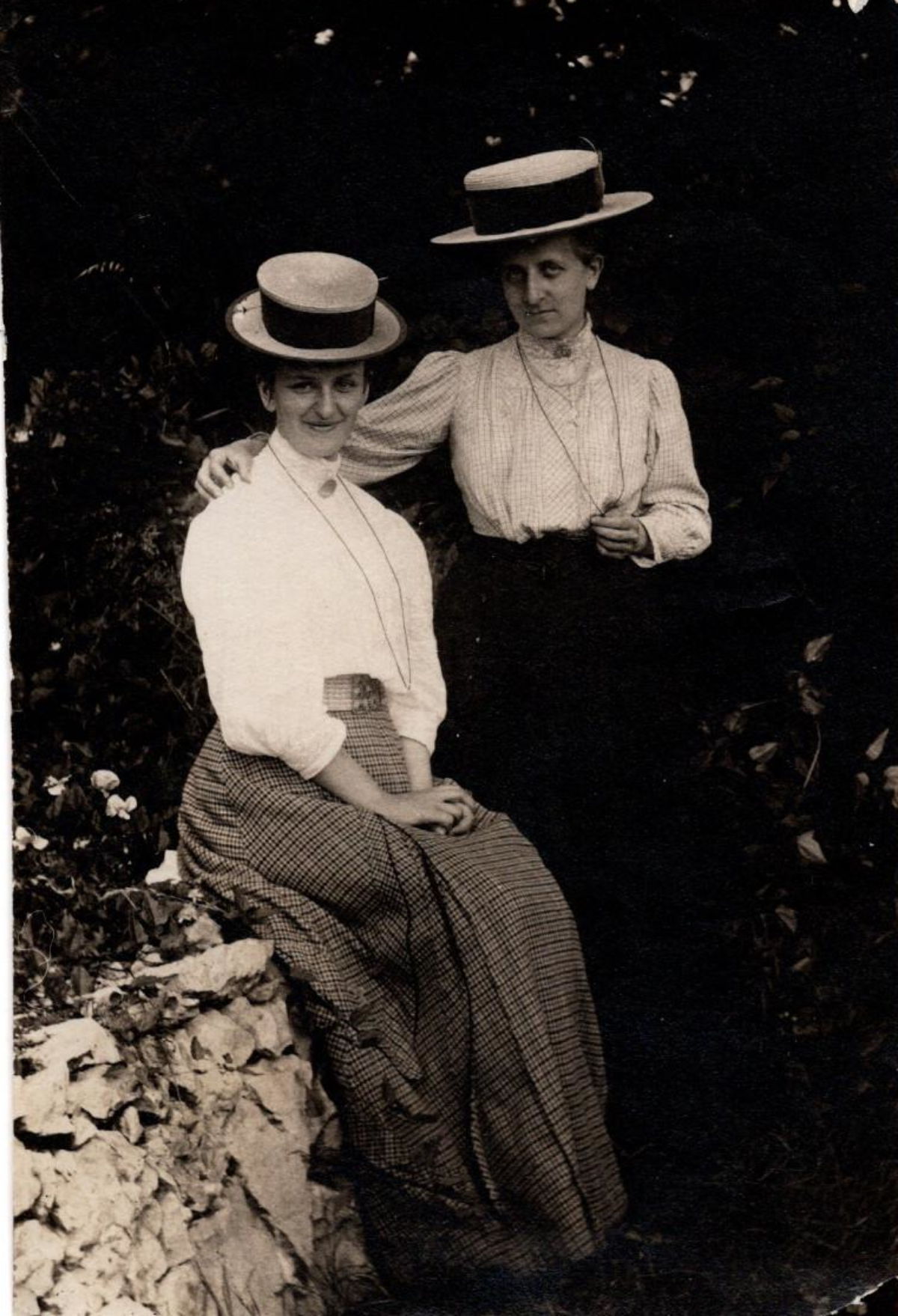Vor Kurzem ist der achte Band der gefeierten Slow Horses-Serie vom britischen Bestsellerautor Mick Herron auf Deutsch erschienen. In Bad Actors, übersetzt von Stefanie Schäfer, verschwindet eine wichtige Mitarbeiterin des Premierministers spurlos, und ausgerechnet Claude Whelan, ehemaliger MI5-Chef, soll sie finden. Doch die Spur führt ihn direkt zurück zum Hauptquartier im Regent’s Park und über Umwege natürlich auch zu Jackson Lamb.

Foto von Adam Wilson auf Unsplash
Zugegeben, wir haben als Erstes nicht den geheimdienstlichen Impuls empfunden, sogleich nach London zu verschwinden, haben weder Mantelkrägen nach oben geschlagen noch die Mütze tiefer ins Gesicht gezogen. Wir haben es uns – so wie’s Roddie Ho tun würde, oder RodBod, Rodster, RodMeister, Rodinator, Roderick beim Rod-eo – hinter dem Computer gemütlich gemacht und haben per Google Street View die üblichen Verdächtigen verfolgt. Dabei haben wir uns natürlich an den Sicherheitsabstand gehalten, der uns im Park eingetrichtert worden ist: weit genug weg, um abzutauchen, nah genug, um das Zielobjekt nicht zu verlieren. «Kapuze auf, Maske auf. Sorgfältig getarnt.»